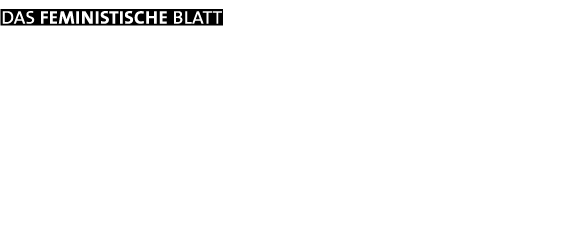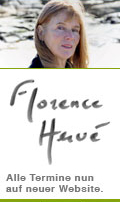„Es ist wichtig, Gewalt klar zu benennen“
von Melanie Stitz
(aus WIR FRAUEN Heft 2/2020, Schwerpunkt: Gewalt)
Melanie Stitz sprach mit der Beraterin Etta Hallenga von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf über ihre Arbeit.
MS: Welche Wege geht Ihr, um Gewalt zu zeigen und zu benennen?
EH: Wir verwenden keine Abbildungen von einem blauen Gesicht oder einer Frau, die verschämt in der Ecke sitzt. Wir arbeiten in unseren Broschüren eher mit einer Sprache, die Mut machen soll, wie „gemeinsam gegen Gewalt“, „Gewalt ist nie privat“ oder „Nein heißt Nein“. Oder mit Aufforderungen an das Umfeld, hinzusehen und einzugreifen. Bebilderung halten wir für sehr schwierig, denn Gewalt ist sehr unterschiedlich. Jede Darstellung schließt automatisch andere aus, schließt Kulturen aus, Lebenslagen, Altersgruppen, Frauen mit Behinderung… So unterschiedlich wie wir Frauen sind, so unterschiedlich erleben Frauen auch Gewalt. Du bekommst das also gar nicht abgebildet. In unserer Broschüre schreiben wir „Wenn es passiert ist…“. Denn auch das erleben wir in der Beratung, dass Frauen erstmal nach Wörtern suchen und gar nicht von Vergewaltigung sprechen. Auch mit dem Begriff „häusliche Gewalt“ können viele nichts anfangen – ein Begriff, zu dem es auch bei uns eine lange Diskussion gab: Er negiert die Täter; das Haus ist etwas positiv Besetztes, sollte es zumindest sein, und ein Haus schlägt nicht. Ähnlich problematisch ist der Begriff „Kindesmissbrauch“ – als gäbe es eine Form von Gebrauch, die in Ordnung wäre. Es geht darum, dass Sexualität benutzt wird, um Macht auszuüben. Wir nennen es sexualisierte Gewalt in der Kindheit.
Wie unterstützt ihr Frauen dabei, sich im juristischen Sinne als Opfer zu begreifen, andererseits aber „Opfer-Sein“ nicht zum Teil ihrer Identität zu machen?
Es ist und bleibt paradox. Für viele Frauen ist es gut, wenn anerkannt wird, dass sie Opfer sind, und wichtig ist es zudem in juristischem Sinne. Gerade in diesem Deliktsbereich ist es typisch, dass Frauen eine Mitschuld gegeben wird, und sie tun das auch oft selbst und fragen: Warum habe ich nicht dieses oder jenes getan, den Mann nicht verlassen usw. Dass Frauen Opfer werden, gilt als etwas Normales, Männern wird das eher nicht zugeordnet. Es hat etwas Kleinmachendes. Nicht von ungefähr gilt „Du Opfer“ als Schimpfwort. Zugleich gibt es eine Erwartungshaltung an Frauen, die Opfer geworden sind, sich entsprechend zu verhalten. Ich hatte eine Frau in der Beratung, die sagte: „Ich erzähle gar nicht, dass ich Opfer von Gewalt geworden bin, sonst fragen sich alle, wieso ich tanzen gehe.“ Manche wollen nicht, dass andere davon wissen, weil sie sonst ihrer Kraft beraubt werden. Es ist Teil ihrer Geschichte, das macht auch etwas mit ihnen, aber es ist nicht Teil ihrer Identität. Ihre Geschichte hat auch noch andere Momente. Ein Opfer wird außerdem immer in Frage gestellt. Niemand möchte gerne Opfer werden. Wenn ich nicht sehr gut reflektiert bin, im Hinblick auf meine eigenen Bilder und Vorurteile, dann schaue ich womöglich auf die Frau mir gegenüber und frage mich: Was hat sie, dass sie Opfer geworden ist? Habe ich das auch? Wenn nicht, dann kann mir so etwas nicht passieren. Es entsteht eben keine Solidarität, sondern Distanzierung und Entsolidarisierung.
Rund um den 8. März wurde die Performance „Der Vergewaltiger bist Du!“, inspiriert von chilenischen Feministinnen, aufgeführt. Wie hast Du diese Performance empfunden?
Wir hatten in unseren Reihen im Vorfeld viele Diskussionen darum. Es erinnert an den Slogan früher „Jeder Mann ist ein potentieller Vergewaltiger“. Das ist überhaupt nicht meine Form und ich denke, da ist auch Vorsicht geboten. Viele Frauen erleben Gewalt durch ihren Partner, aber wir wissen nicht, wie viele Männer dahinterstehen. Wir haben oft mehrere Frauen in der Beratung, die vom selben Täter geschlagen wurden, also nacheinander mit demselben Mann liiert waren. Gerade in diesem Deliktbereich wird Frauen zudem oft unterstellt, Fehlbeschuldigungen zu machen. In der Performance werden auch Staat und Polizei angeklagt. Ich denke, die Erfahrungen von Frauen in Chile lassen sich jedoch nicht 1:1 auf deutsche Verhältnisse übertragen. In Chile oder auch Mexiko und Kolumbien hat die Gewalt, die Frauen erleben, z.B. auch durch Paramilitärs, nochmal andere Formen und ist viel gedeckelter durch Polizei und Staat. Das kann man hier nicht so sagen. Wir arbeiten gut mit der Polizei zusammen. Es gibt da einfach Unterschiede. Einen kraftvollen gemeinsamen Ausdruck, am 8. März oder am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, finde ich jedoch wichtig. Wie der gemeinsame Tanz bei One Billion Rising –kulturell übergreifend steht er für Solidarität, Kraft und Stärke pur.
Viele Feministinnen fordern, den Begriff des Feminizids zu verankern und die Tötungen von Frauen durch ihre (Ex-)Partner auch so zu benennen. Wie diskutiert Ihr das?
Das ist bei uns klar! Wenn es in den Medien heißt Familienstreit, Beziehungsdrama oder gar erweiterter Suizid, dann sind das begriffliche Umdeutungen und Verharmlosungen, die teilweise sogar eine Mitschuld nahelegen. Bei einem Banküberfall würde auch niemand sagen, „da hat sich jemand illegal Geld genommen“. Es ist total wichtig, Dinge klar und deutlich zu benennen. Denk an die Vergewaltigung in der Ehe: Den Begriff gab es früher nicht, das haben wir erkämpft. Heute ist es ein Straftatbestand. Auch für Stalking gab es lange keinen Begriff, man sprach von Liebeswahn, Schwärmerei oder gar Liebesbeweisen.
Würdest Du den Gewaltbegriff weiter fassen wollen als unmittelbare Körperverletzung? Welche Rolle spielt z.B. Armut?
Was wir in der BRD formal als Gewalt verstehen, ist eher tätliche, direkt körperliche Gewalt. Stalking, psychische und ökonomische Gewalt wurden bislang nicht so gefasst, das ändert sich langsam. Frauen, die Gewalt erfahren haben, berichten oft, dass die psychische Gewalt viel länger nachwirkt. Die Schläge sind irgendwann vorbei. Armut und ökonomische Abhängigkeit machen Frauen verwundbar. Für arme Frauen ist es viel schwieriger, sich Schutz zu suchen, wenn das Geld nicht reicht für ein Handy, die Miete nicht bezahlt werden kann usw. Abhängigkeit macht Frauen verwundbar. Aber Abhängigkeitsverhältnisse wirken auch andernorts. Auch reichere Frauen sind betroffen. Ihnen fällt es aber oft schwerer, sich als Opfer zu begreifen und Hilfe zu suchen, weil sie nicht ins Opfer-Bild passen. Opfer, so das Klischee, sind in der Regel Migrantinnen und arme Frauen. Der erste Schritt ist aber immer, anzuerkennen, dass ich Opfer geworden bin und Rechte habe. Es gibt übrigens auch Zahlen, die nahelegen, dass Frauen, die mehr verdienen als ihr Partner, einem höheren Gewaltrisiko ausgesetzt sind. Das Thema hat viele Facetten. Deutlich ist: Es geht immer um Macht.
Angesichts der Corona-Pandemie: Konntet Ihr den Betrieb aufrechterhalten und Erreichbarkeit sicherstellen? Inwiefern haben die Einschränkungen Frauen besonders getroffen?
Die Situation ist wie ein Vergrößerungsglas. Für uns, aber auch für die Frauen. Wir als Frauenberatungsstelle müssen damit zurechtkommen, keine ausreichende technische Ausstattung zu haben, und es gibt zurzeit generell keine gesicherte Plattform für z.B. Onlineberatungen. Auch die Übernahme der Kosten für Telefondolmetschen ist noch nicht geklärt. Die Begleitung zu Ämtern ist erschwert. Aber wir suchen kreativ nach Lösungen. Gewalt gegen Frauen ist nicht etwas, was es erst seit Corona gibt. Generell können sich aber Ängste und Sorgen verstärken. Es ist eher nicht zu erwarten, dass bislang respektvolle Beziehungen plötzlich in Gewaltbeziehungen umschlagen, aber dort wo bereits vor der Krise Probleme waren, ist eine Verschärfung der Situation zu vermuten, gerade wenn auf engem Raum zusammengelebt werden muss und es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt. Wir befürchten in erster Linie die Zunahme von Übergriffen gegen Kinder in der Familie. Wir haben sogleich ein Krisenprogramm entwickelt und die telefonische Erreichbarkeit ausgeweitet. Die Stadt Düsseldorf stellt Apartments zur Verfügung, um Frauen und Kinder sicher unterzubringen. Wir sind im Prozess. Im Moment haben wir nicht mehr Anfragen als sonst. Auch von anderen Beratungsstellen haben wir bislang noch keine Meldungen von totaler Überlastung erhalten (Stand 20. April). Womöglich spielt sogar das gute Wetter eine Rolle – auch das macht etwas mit Menschen. Aber auch die fortwährende Meldung „bleibt zu Hause“, „fast alles ist geschlossen“ und „Dienstleistungen bitte nur im Notfall in Anspruch nehmen“. Es gibt sogar Frauen in unserer Beratung, die ohnehin nicht gerne aus dem Haus gehen und die Zeit gerade als Entlastung erleben. Es gibt also auch überraschende Effekte. Ich halte nicht viel von Panikmache und bin bei dem Thema vorsichtig. Gewalt gegen Frauen ist Teil des sogenannten Normalzustandes, kein der Krise geschuldeter Sonderfall.
Wir hoffen jedenfalls, dass der Eindruck nicht trügt und es so bleibt. Wenn etwas sein sollte, sind wir da!