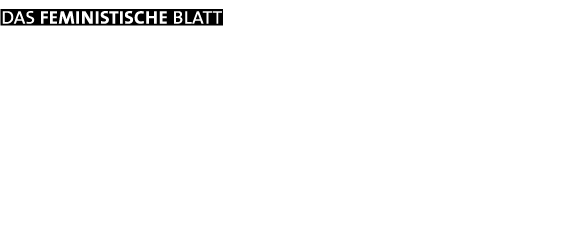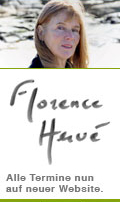White girl Problems
Kürzlich wurde eine US-amerikanische Studie veröffentlicht, die knapp zusammengefasst besagt, dass sich Fernsehkonsum äußerst positiv auf das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen auswirkt – vorausgesetzt, sie sind weiß, männlich und heterosexuell. Für alle anderen gilt das genaue Gegenteil: Das Selbstwertgefühl sinkt, denn es gibt keinerlei positiv besetzte, komplexe und motivierende Rollenvorbilder. Vor allem bei Mädchen und jungen Frauen hinterlassen die eindimensionalen, „sexy“ Fernsehfrauen deutliche Spuren in ihrer Selbstwahrnehmung. Das allabendliche Gestöckle auf der Suche nach Mr. Right ist also nicht nur blödsinnig, sondern auch schädlich. Gut, dass es ein paar Ausnahmen gibt.
Die am 15. April erstmals auf HBO ausgestrahlte Serie Girls soll so eine Ausnahme sein. Im deutschen Fernsehen wird sie ab Herbst auf dem neu gestarteten Bezahlsender glitz* zu sehen sein. Autorin, Produzentin, Regisseurin und Hauptdarstellerin ist Lena Dunham, die dafür drei Emmy-Nominierungen erhalten hat. Die 25-Jährige hat Creative Writing studiert und debütierte mit ihrem Indie-Film Tiny Furniture, in dem sie ebenfalls die Hauptrolle übernahm und der die Startschwierigkeiten einer jungen Frau nach ihrem College-Abschluss ins „richtige“ Erwachsenenleben erzählt. Mit Girls bleibt sie dem Coming-of-Age-Genre treu. Die Serie handelt von vier New Yorkerinnen Mitte 20, die versuchen, zwischen schlechten Jobs, emotionslosem, unbefriedigendem Sex, Unsicherheiten, unrealistischen Erwartungen, unbezahlten Rechnungen und allem, was sonst so dazugehört, irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen.
Da wäre zunächst einmal Hannah (Lena Dunham): Eigentlich ist sie Schriftstellerin, uneigentlich ist sie Praktikantin. Als ihre Eltern ihr den Geldhahn zudrehen, landet sie sehr unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Ihr Chef verwandelt ihr unbezahltes Arbeitsverhältnis nicht in ein bezahltes, sondern in ein gekündigtes.
Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Marnie (Allison Williams) arbeitet als Assistentin in einer Kunstgalerie und ist von ihrem langjährigen Partner, der ihr nicht machohaft genug ist, so genervt, dass sie jegliches sexuelle Interesse an ihm verliert und ihn schließlich verlässt, was sie in tiefe Selbstzweifel stürzt.
Zum Kreis gehören außerdem Shoshanna (Zosia Mamet), deren ärgstes Problem bis zum Staffelfinale ihre Jungfräulichkeit ist, und Jessa (Jamima Kirke), Shoshannas Cousine, ihres Zeichens Bohémienne, sie schlägt sich als Babysitterin durch und wertet ihr Selbstwertgefühl durch Flirten auf.
Vier Frauen in New York? Natürlich kommt uns das allen mächtig bekannt vor. Der Vergleich mit Sex and the City drängt sich geradezu auf. Die „große Schwester“ SATC, wie sie in Fankreisen heißt, wird durch die Figur Shoshanna thematisiert, die ironischerweise noch Jungfrau ist. Geschickt wird dabei persifliert, wie viel das Leben dieser vier New Yorkerinnen mit dem tatsächlichen Leben ihrer glühenden Fans oft gemeinsam hat. Nämlich gar nichts. Girls ist nicht einfach nur die „jüngere“ Version des Auslaufmodells Sex and the City, auch wenn die Serie so vermarktet wird. Girls ist die kleine, ernste Schwester, die lernen musste, dass anything goes keine Motivation, sondern eine Lüge ist. Jobs fliegen einer nicht zu, auch wenn frau noch so hart arbeitet und noch so gut ausgebildet ist. Auch der Status als Praktikantin will erst einmal finanziert werden, und zwar von den Eltern. Die Girls sind die Kinder einer ganz anderen Zeit als die vier Ladys: das Amerika nach der Wirtschaftskrise. Geblieben ist ihnen aber der Traum vom glamourösen Erwachsenen-(Frauen-)Leben.
Dunhams Serie beschreibt damit eine Lebenswirklichkeit, wie sie kürzlich das „Alphamädchen“ Meredith Haaf in ihrem Buch „Heult doch. Über eine Generation und ihre Luxusprobleme“ versucht hat, analytisch einzufangen: Apathische Stagnation und neurotische Nabelschau bei gleichzeitiger Vielfalt der Möglichkeiten, die man seiner Herkunft verdankt. Anders als Haaf porträtiert Dunham ihre Leidensgenossinnen und -genossen nie anklagend und mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem ebenso schonungslosen wie selbstironischen Blick. Beispielsweise, als Jessa glatte zwei Stunden zu spät zu ihrer eigenen Willkommensfeier erscheint, sie sei da nicht so spießig. Oder als Hannah ihren Eltern vorrechnet, dass sie ihr Leben als freie, sprich unbezahlte Autorin mit 2.000 US-Dollar monatlich unterstützen sollen, sie sei da bescheiden.
Anders als so viele „Frauenserien“ hat Girls nicht nur begriffen, dass bestimmte Unerfreulichkeiten des Lebens, wie Abtreibung oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, direkt mit dem Vorhandensein einer Vulva zusammenhängen, sondern sie werden auch thematisiert.
Die Serie schafft es außerdem, die häufig als trivial abgetanen alltäglichen, unsichtbaren Frauenprobleme als das zu zeigen, was sie sind: Probleme von Frauen. Probleme, die daraus resultieren, weiblich sozialisiert worden zu sein und von seiner Umwelt anhand eines weiblichen Kriterienkatalogs beurteilt zu werden; die existentiellen Unsicherheiten beispielsweise, die damit einhergehen, hauptsächlich anhand der äußerlichen Erscheinung beurteilt zu werden, oder die Fixierung auf romantische Paarbeziehungen, wenn es klüger wäre, die eigene Karriere zu planen, die Scheu, auf ihrem eigenen Orgasmus zu bestehen, aus Angst, den Partner zu verlieren, aber auch die tiefen Wunden, die sich nur beste Freundinnen zufügen können, mit ihrer jahrelang angestauten Wut.
Auch wenn in der Serie nie das Wort Feminismus fällt, handelt es sich dennoch um einen eindeutigen, ja fast schon klassischen Kanon an feministischen Themen, die hier durchdekliniert werden. Ganz alte Hüte der Frauenbewegung werden da klammheimlich einem Mainstream-Publikum untergejubelt: Sex, Arbeit, reproduktive Rechte, Beziehungen, Liebe, Freundschaft, Schönheitsnormen etc.
Somit ist Girls eine feministische Serie für Nicht- oder Neufeministinnen und damit für alle Frauen, die Feminismus dringend nötig haben, weil sie gar nicht erst auf die Idee kommen, dass ihre Probleme Frauen-Probleme sind. An dieser Stelle mag der durchaus berechtigte Einwand kommen: Das hatten wir alles schon mal. Ja, völlig richtig – aber wo ist dieses Wissen hin? Meiner Meinung nach ist das ausdrücklich nicht die Gelegenheit für alte Häsinnen der Frauenbewegung, auf die Neuen herabzublicken, die mal wieder das ganze, hart erarbeitete feministische Erbe verspielen – es ist eine gute Zeit, uns ALLE zu fragen, warum so wichtiges (feministisches) Wissen an manchen Frauen vorbeizugehen scheint.
Ein viel drängenderes Problem ist allerdings die Frage nach der medialen Repräsentation – wessen Leben wird hier dargestellt? Die Girls, das sind weiße, heterosexuelle Frauen aus der gehobenen Mittelschicht, deren Freundes- und Liebeskreis aus anderen weißen, heterosexuellen Menschen der Mittelschicht besteht. Eine Art urbane Käseglocke.
In der Diskussion, die um die Serie geführt wurde, hat sich interessanterweise vor allem der Faktor Hautfarbe als einer der Hauptkritikpunkte abgezeichnet und nicht etwa sexuelle Orientierung oder Klasse. Und natürlich, Dunham hat eine weitere Serie geschrieben, in der nur Weiße auftreten. Und ja, angesichts der ethnischen Pluralität New Yorks grenzt es schon fast an Ignoranz, nur Weiße auftreten zu lassen. Lena Dunham hat eine wichtige Chance verspielt, bei der Darstellung der Lebenswirklichkeit von Frauen über den eigenen, weißen Tellerrand hinauszublicken.
Aber sie hat genauso die Chance verspielt, etwas über das Leben von Frauen aus der Unterschicht oder über lesbische Frauen zu erzählen. Es drängt sich die Frage auf, warum ausgerechnet von ihr erwartet wird, dass sie alle Kriterien erfüllt.
Nicht bei jeder neuen, männerzentrierten Serie folgt schließlich ein derartiges mediales Echo aus Kolumnen, Blogeinträgen und Artikeln, die die mangelnde ethnische Pluralität kritisieren. Vielleicht waren die Hoffnungen umso größer, endlich auch die eigene Lebenswirklichkeit repräsentiert zu sehen, eben weil Girls aus dem Serieneinheitsbrei heraussticht.
Also: Girls – das sind die Probleme von weißen, heterosexuellen Frauen des gehobenen Mittelstandes. Nichtsdestotrotz erzählt die Serie etwas über die Lebenswirklichkeit von Frauen, zumindest von einer kleinen Gruppe von Frauen. Ohne damit im Geringsten sagen zu wollen, dass nicht mehr (weibliche) Realitäten erzählt werden sollten. Das sollten sie, und zwar dringend. In all ihrer Vielfalt. Dunhams Werk ist ein kleiner, unperfekter Beitrag zu einer pluralen Medienlandschaft. Immerhin.
Zum Weiterlesen
Anna Schiff