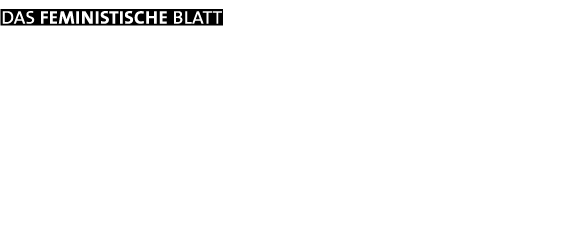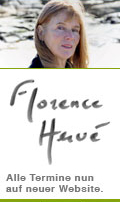Von illegalen Hühnereiern
Die Vogelgrippe und die Folgen
Ich möchte eine Geschichte erzählen, die deutlich macht, wie vor gar nicht allzu langer Zeit die Restbestände der traditionellen dörflichen Selbstversorgung erschüttert wurden.
Es gab in den vergangenen Jahrzehnten mehrere große Einschnitte in die dörfliche Selbstversorgung. Einer davon war, dass die traditionelle Hausschlachtung durch komplizierte Verordnungen kaputt gemacht wurde. Viele kleine Hausschlachter gaben ihre Tätigkeit auf, weil sie die behördlichen Vorgaben nicht erfüllen konnten, und damit verbunden hörten viele private Haushalte auf, Tiere für die Fleischgewinnung zu halten. Ähnlich war es bei der Milchversorgung. Konnte man noch vor einigen Jahren beim Bauern eine Kanne Rohmilch holen, musste plötzlich jeder Milchbauer die Milch sterilisieren, bevor er sie abgeben durfte. All diese verkomplizierenden Maßnahmen machten die Direktvermarktung für kleine Vermarkter quasi unmöglich. Sie bauen immer auf der Argumentation des Verbraucherschutzes auf. Dass es der beste Schutz sein kann, eine persönliche Beziehung zum und damit Einflussmöglichkeit auf den Erzeuger zu haben, gerät in Vergessenheit.
Der letzte große Einschnitt in die Selbständigkeit der dörflichen Selbstversorgung war die „Hühnergrippe“. Viele alte Menschen, die noch ihre fünf, sechs Hühner hinter dem Haus hielten, gaben in dieser Zeit auf, weil sie nicht die räumlichen Möglichkeiten oder Finanzkraft hatten, Umbauten vorzunehmen. Der Vorsitzende des hiesigen Geflügelzuchtvereins erzählte mir, dass bis zu 40% der privaten Geflügelhalter ihre Tiere abgeschafft hätten. Er geht davon aus, dass in den nächsten 10–15 Jahren die Geflügelzuchtverbände aussterben werden, weil es kaum noch private Geflügelhalter gibt. Für Außenstehende mag ein Geflügelzuchtverein mit seinen Ausstellungen etwas Seltsames sein, abgesehen davon ist er Informationsbörse, Ort für Erfahrungsaustausch und altes Wissen über Züchtung und Haltung.
Auch mich kostete die neue Voliere, trotz geschenkten Holzes und Drahts, noch 150 Euro für Überdachung und Schrauben. Dafür hätte ich 600 Bio-Eier kaufen können. Aber mir ging es darum, weiterhin eigene Hühner halten zu können und damit die Kontrolle über die Fütterung und Haltung zu haben. In der Nachbarschaft bauten wir die Volieren nicht zum Schutz vor infizierter Zugvogelkacke, sondern zum Schutz vor Anzeigen durch panische Mitmenschen. Die Panikmache in den Medien zeigte große Wirkung. Verunsicherte Menschen, die selbst keine Tierhaltung betrieben und scheinbar überhaupt nicht einschätzen konnten, wie groß die Gefahr tatsächlich war (zw. 50 und 60 Todesfälle durch SARS in ganz Asien im Herbst `05), zeigten Tierhalter an, die sich nicht an die Aufstallung hielten. Niemandem von den Nicht-Tierhaltern schien aufzufallen, dass in Europa die Krankheitsfälle beim Geflügel gerade in großen, hermetisch abgeriegelten Massenställen auftraten, trotz (oder wegen?) keimfreier Haltung und medikamentöser Dauerbehandlung. Womit für uns die Theorie von Ansteckung über infizierte Zugvogelkacke an Argumentationskraft verlor. Niemand schien in Zusammenhang zu bringen, dass die Aktien von Roche unaufhörlich stiegen (Vertrieb von Tamiflu) oder die Hausärzte gar nicht mehr mit Grippeimpfungen nachkamen.
Private Tierhalter wurden aufgefordert, ihre Tiere a) bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung anzumelden, b) beim Kreisveterinärsamt, c) bei der Tierseuchenkasse des jeweiligen Bundeslandes, damit die Behörden im Falle einer Seuchenausbreitung Zugriff auf die Tiere haben können. Erzeuger oder private Tierhalter, die in Verbänden organisiert sind und z. B. auf Ausstellungen und Messen fahren, müssen sowieso registriert sein. Endlich gab es einen Anlass, auch bei der Geflügelhaltung all die kleinen Selbstversorger am Kragen zu packen, so wie zuvor bei der privaten Pferde- und Klauenviehhaltung. Kreisveterinäre fuhren über die Dörfer und spionierten herum, Anzeigen wurden erstattet. Einige illegale Hühnerhalter wurden mit horrenden Strafzahlungen belegt, weil die Maschengröße ihrer Volieren nicht den Vorgaben entsprach oder sie ihre Tiere weiterhin im Freien hielten.
Wir Nachbarn beschlossen, die Tiere zu Zeiten, in denen sich kaum Besucher oder Spaziergänger in der Straße aufhalten würden, auf die Freiflächen zu lassen. Jeder von uns hat Volieren, die weit über die vorgeschriebene Flächennorm hinausgehen, trotzdem kam es uns krankheitsprovozierend vor, Tiere einzusperren, die es sonst gewöhnt waren, sich frei auf mehreren 100 qm großen Obstwiesen zu bewegen und sich ihren Speiseplan neben dem verfütterten Getreide selbst nach Bedarf zusammenzustellen, von Käfern, Würmern, über Fallobst, Grünfutter und Samen.
Außerdem vereinbarten wir, uns nirgendwo registrieren zu lassen. Denn wir konnten uns genau ausmalen, was dem – außer Verwaltungsgebühren – folgen würde. Bei Ausbruch einer Seuche: Impfung und Behandlung mit Medikamenten oder Tötung der Tiere. Zwar würden wir pro Tier Centbeträge als Entschädigung bekommen und könnten damit neue Küken kaufen, aber niemals die alten Zuchtlinien ersetzen. Die Entschädigungszahlungen lohnen sich nur für die ganz großen Anlagen. Die machen in manchen Fällen sogar etwas Gewinn, wenn z. B. der Geflügelpreis schlecht ist, wie zu Zeiten der „Hühnergrippe“. Wir würden unsere Tiere im Falle dessen selber töten und auch selber essen.
Die Geflügelhalter in meiner Nachbarschaft, vorwiegend ältere Männer, waren sich einig, dass es darum geht, die „Kleinen“ kaputt zu machen, um der industriellen Geflügel- und Eierproduktion ein uneingeschränktes Monopol einzuräumen.
Eine Gruppe hatte auf jeden Fall von der „Hühnergrippe“ profitiert: die Pharmaindustrie. Und zwei hatten verloren, und zwar Lebens- und Nahrungsmittelqualität: die Tiere sowieso, aber auch die Verbraucher. Frau Meier von nebenan, weil sie ihre Hühner abgeschafft hat, die ihr immer sehr viel Freude machten, und Frau Rosalski aus dem Neubaugebiet. Die kauft jetzt nämlich ihre Eier im Supermarkt, weil sie Angst hat, unsere illegalen Eier könnten krank machen.
Christine Hahn