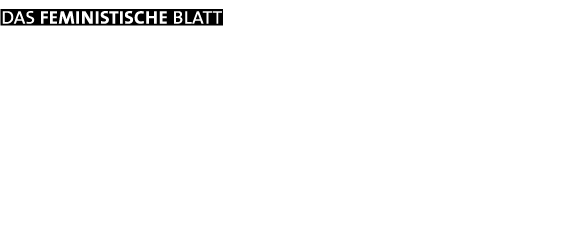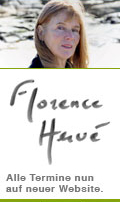Vom Tun und vom Lassen
TuBF Bonn: 30 Jahre Therapie und Beratung für Frauen
Seit 30 Jahren haben die Mitarbeiter_innen der TuBF Frauenberatung in Bonn mit Überzeu-gung, Sachverstand und kollektivem Mut Frauen begleitet und psychotherapeutische Prozesse angestoßen. Sie haben ermutigt, sich berühren und anrühren lassen, manchmal mitgeweint und nicht selten gelacht. Sie haben sich beeindrucken lassen von dem Mut und der kreativen Energie, mit der Klient_innen ihre eigenen Wege aus dem Schmerz gefunden haben. Sie haben Frauen dabei unterstützt, ihre Bedürfnisse und Interessen zu formulieren und zu vertreten – und sie haben ihren eigenen Arbeitskontext eigenverantwortlich gestaltet. Gleichwohl haben sie mit jeder Entscheidung andere Möglichkeiten hinter sich gelassen. Sie lernten zu würdigen, was alles erreicht wurde, den Steinen – nicht nur denen unter dem Pflaster –, die sie in die Wasser der Welt warfen, auch die Zeit zu lassen, Kreise zu ziehen, etwas zu bewegen, zu wirken.
Als Team stellen sie eine hohe Qualität der Arbeit sicher und setzen sich dabei kritisch mit dem modernen „Qualitätsmanagement“ auseinander.
Infolge der neoliberalen Welthandelspolitik öffnete der EU-Binnenmarkt seine Grenzen nicht mehr nur für Güter (und noch lange nicht für alle Menschen), sondern auch für öffentliche Dienstleistungen. Der Dienstleistungssektor hat die höchsten Wachstumsraten und erwirtschaftet über 60 % des globalen Bruttosozialprodukts. Das weckt Begehrlichkeiten für Privatisierungen und grenzüberschreitenden Handel. Dieser Handel mit Dienstleistungen machte Mess- und Vergleichbarkeit, vormals nur für industriell gefertigte Güter bekannt, nun auch für die Dienstleistungen nötig. Im neu entstandenen Markt wurde das entsprechende Instrumentarium „Qualitätsmanagement“ (QM) benannt. Dieses Instrumentarium war anfänglich schwer durchschaubar, denn Qualität für die eigene Arbeit zu dokumentieren war verführerisch, hat jedoch das Arbeiten im sozialen und Gesundheitssektor erschreckend verändert und neues Denken in Zertifizierungs- und QM-Begriffen konstituiert.
„Psychische Belastung“ wird z. B. mit der Norm DIN EN ISO 10075 erfasst. Die internationale Maßeinheit für Krankheit ist DALY: disability-adjusted life years. Dieser Wert berechnet z. B. Behinderung als verlorene Lebensjahre, multipliziert mit einem bestimmten Prozentwert je nach Höhe der Behinderung. Um so eine Maßeinheit für „Lebensqualität“ zu konstruieren, wird ein negativer Behinderungsindex angesetzt, der bei hohen Werten eine niedrige Lebensqualität beschreibt: das behinderungsbereinigte Lebensjahr (DALY). Dieses Konzept geht darüber hinaus davon aus, dass die Belastung durch eine bestimmte Krankheit oder einen bestimmten Unfall überall auf der Welt dieselbe ist und ignoriert komplett länder- und kulturspezifische Unterschiede. Solche irrsinnigen Messinstrumente werden entwickelt, wenn auch Gesundheitsdienstleistungen zum global berechenbaren Geschäft werden.
Ob nun Gesundheit oder das Soziale als Marke verkauft wird, es hat zur Folge, dass Myriaden von Controller_innen und Berater_innen, die oftmals von der fachlichen Arbeit keine Ahnung haben, sich eine goldene Nase damit verdienen, ihre Kosten-Nutzen-Maßstäbe zum unhinterfragbaren Maßstab zu erheben. Dr. med. Manuel Derron hat das bereits 2003 in der Schweizerischen Ärztezeitung unter dem Titel: „Kann das Qualitätsmanagement das Jahr 2004 erleben“ wunderbar beschrieben.
Die therapeutisch/beraterische Arbeit der TuBF jedoch „produziert“ keine Gesundheit, Heilung oder Ganzheit, sondern bewegt sich an der hochsensiblen Schnittstelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Es geht um intime, private Erfahrungen aus komplexen Biographien lebendiger und sich verändernder Frauen, die sich in einem mehrdimensionalen sozialen System bewegen. Diese zwischenmenschlichen Prozesse lassen sich nicht einfach erfassen wie der DIN-Wert beim Papierformat. Qualitätshandbücher und Zertifizierungen sollten also nicht mit Anerkennung, Aufwertung oder Verbesserung der Arbeit verwechselt werden.
Vielmehr braucht es öffentliche Räume, wo Grenzen der therapeutischen, medizinischen oder sozialarbeiterischen Arbeit und die Fallstricke von Pathologisierung und Individualisierung besprechbar sind, und zwar jenseits von Mess- und Erfolgskriterien. Es braucht Raum zur Reflektion über einen gesellschaftlichen Umgang mit unmittelbaren und strukturellen Gewaltpotenzialen, mit denen Frauen auf spezifische Weise konfrontiert sind, ohne aus spendentaktischen Gründen oder um notwendige öffentliche Förderung zu erkämpfen, Frauen medial doch immer wieder auf den Opferstatus zu reduzieren.
Wie gewaltförmig oder mitmenschlich die jeweiligen Lebens- und Wirtschaftsordnungen auch sein mögen, wie viele Identitätsmöglichkeiten eine Gesellschaft auch verhindert, anbietet oder erfordern mag, immer erbringen diese Frauen eine hohe kreative Leistung, einen eigenen Ort der inneren und manchmal äußeren Beheimatung zu finden. Das eigene Begehren und gesellschaftliche Normierungen auszubalancieren, bleibt ein riskanter Ritt auf dem Zaun und es gehört zum Menschsein, dass das nicht immer bruchlos gelingen kann.
Verletzlichkeit, Einschränkung, Schmerz und Scheitern sollten deshalb für ebenso menschenwürdig erachtet werden wie Freude, Erholung, Zufriedenheit und inneres Wachstum.
Auf dem 14. deutschen Trendtag in Hamburg stellte der Marktforscher David Bosshard die Resilienz der Effizienz gegenüber. Resilienz bezeichnet in der Psychologie die Widerstandsfähigkeit, an Belastungen und Krisen nicht zu zerbrechen, sondern über soziale und psychische Unterstützungsfaktoren zu verfügen, die Selbstvertrauen und Regeneration ermöglichen. Ressourcenorientierung oder Resilienzförderung sind Grundlagen, um großes Leid überhaupt bearbeiten zu können, ohne neu überfordert oder überwältigt zu werden.
Für Bosshard jedoch ist Resilienz die robuste weibliche Kraft, der er Folgendes zuschreibt: „innere Kraft, den Kontext sehen, Homeworking, Networkung, Shitworking „vimeo.com“, eine Kraft, die der Markt der Zukunft brauche, weil nur mit ihr Effizienz erst ermöglicht werde.
Wenn also Teile der Marktforschung den unsichtbaren Anteil der Frauenarbeit nicht weiter ignoriert, sondern ihn ins Blickfeld rücken wollen, braucht es die Klugheit der Unterscheidung, ob es dabei um Emanzipationspotenzial oder Verwertungslogik geht. Denn: Was interessiert einen Marktforscher an Resilienz? Bosshard: „weil das Wachstumspotential sehr viel größer ist, wenn man Hoffnung hat, als wenn man Angst hat.“ Und er meint damit kein inneres Wachstum.
Neuzeitliche Marktökonomie bedient sich der Philosophie, Soziologie und Psychologie und das macht sie richtig gefährlich. Sie reproduziert die immer größer werdende Schere im Kopf zwischen einem ALLES-IST-MÖGLICH, soweit es individuelle Flexibilität, Körperkult, Konsum und persönliche Gesundheitskonzepte betrifft, und einem ES-GIBT-KEINE-ALTERNATIVE, soweit es gesellschaftliche Strukturen oder wirtschaftliche Verantwortlichkeiten betrifft.
Machen wir es zu unserer Ressource, achtsam zu sein und die Sehnsucht nach Freiheit nicht zu verwechseln mit der Beliebigkeit und Illusion der Wahlfreiheit: zu kaufen, was ich will, auszusehen, wie es mir passt, das Geschlecht zu wählen, wie es mir entspricht …
Empowerment in Therapie und sozialer Arbeit bedeutet die Kunst, gerade angesichts der pro-klamierten Freiheiten die hohen Normierungsgrade zu erkennen und einen tatsächlich selbst-bestimmten Weg jenseits von permanenter Selbstoptimierung zu erfinden.
Bleiben wir also unberechenbar und beständig, verbunden und aufsässig, klug und sinnlich, und reden wir weiter auch persönlich miteinander und pflegen wir fassbare Freundschaften, wie real oder virtuell sie auch immer zustande kommen.