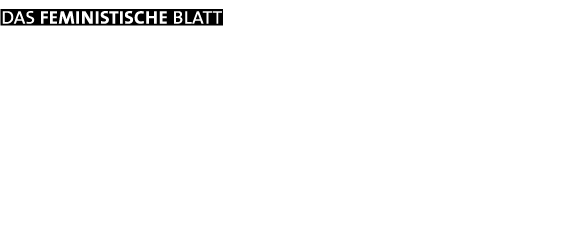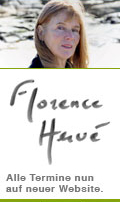Unterschätzte Löwinnen
Wie sich CFM-Beschäftigte in Berlin einen Tarifvertrag erstreikten
von Sigrun Matthiesen
(aus WIR FRAUEN – Das feministische Blatt Heft 3/2025)
„Mein schönster Moment im Streik war, als mein Chef die Toilette sauber gemacht hat.“ Anica grinst, tauscht einen vieldeutigen Blick mit ihrer Kollegin Vida und nimmt einen Schluck von ihrem Rosé. Die beiden Frauen feiern mit rund 80 Kolleg*innen und Unterstützer*innen beim Sommerfest den erfolgreichen Tarifabschluss des ausgegliederten Berliner Krankenhaus-Dienstleisters Charité Facility Management (CFM). Dort sind 3.000 Menschen beschäftigt, die nie in Krankenhausserien vorkommen und von denen für einen 100 Euro Corona-Bonus noch Dankbarkeit erwartet wird.
CFM-Mitarbeitende warten an den drei Standorten der Charité die Elektrik und Klimaanlagen, sie kümmern sich um Sterilisation, Bettenbereitstellung, Krankentransport, Essensversorgung und einiges Lebensnotwendige mehr. Vor allem aber sind bei der CFM rund 800 Reinigungskräfte beschäftigt, ohne deren Arbeit jeder Krankenhausalltag auf der Stelle zusammenbräche. Nur folgerichtig also, dass die 48 Streiktage, mit denen der Tarifvertrag erzwungen wurde, ohne sie niemals möglich gewesen wäre.

Auf dem Fest, gut sechs Wochen nach Ende des Streiks, ist jede Rede voll des Lobes für diese „kämpferischen Kolleg*innen, aus der Reinigung“. Dass viele der Redner diese Kolleginnen ein halbes Jahr zuvor weder kannten, noch ihnen irgendeine Art politischen Kampfes zugetraut hätten, überrascht Enisa kein bisschen. „Man ist gewachsen in dem Streik“, stellt sie auf einer Demonstration Anfang Juni fest. Zu diesem Zeitpunkt ist sie zwei Wochen verdi-Mitglied und hat gerade auf dem Lautsprecherwagen eine mitreißende Rede vor knapp 1.000 Menschen gehalten. Darüber, was 20 % weniger Lohn, die CFM-Beschäftigte im Vergleich zu den direkt bei der Charité angestellten Kolleginnen für exakt dieselben Tätigkeiten erhalten, konkret bedeuten: dass sie als Reinigungskraft auf wirklich jede Schichtzulage angewiesen ist, und deshalb fast jedes Sonntagsfrühstück mit der Familie verpasst; dass eine Frühschicht nicht, wie es im Dienstplan steht, um vier Uhr beginnt, sondern schon um zwei, wegen des langen Arbeitsweges aus den Stadtvierteln mit den noch gerade bezahlbaren Mieten. Für andere Kolleginnen aus der Reinigung oder aus der ähnlich schlecht bezahlten Essensversorgung geht es um Überweisungen ins Ausland, die dort alte und kranke Familienangehörige am Leben halten oder auch darum, endlich den gewalttätigen Partner verlassen zu können. Mit solchen Erfahrungen angereichert, klingen flotte Gewerkschafts-Slogans wie „TVÖD für alle an der Spree!“ und „Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag!“ gleich anders. Auch wenn man weiß, dass viele der Reinigungskräfte während des Streiks von Vorgesetzten an der U-Bahn-Station abgefangen wurden und durch Falschinformationen oder offene Drohungen zur Arbeit gezwungen werden sollten.
Diese Repressionen und besonderen Belastungen waren ein Grund, den Frauen aus der Reinigung und der Küche keinen Arbeitskampf zuzutrauen. „Die haben zu viel Angst“ war die herrschende, gut gemeinte, gefühlte Wahrheit, sowohl bei den Kollegen aus den handwerklichen Berufen wie bei so manchem altgedienten Gewerkschaftskämpfer. Weshalb sich verdi in den Tarifauseinandersetzungen 2011 und 2020 vorrangig auf die ordentlich Organisierten in den höheren Entgeltgruppen gestützt hatte – überwiegend Vollzeit-Facharbeiter ohne Migrationsgeschichte. Eine Strategie, die mit dazu beigetragen hat, dass es bis zu diesem Jahr gerade mal gelungen war, einen Haustarifvertrag mit Einstiegsgehältern auf Mindestlohn zu erwirken. Bei der Mehrheit der Beschäftigten – weiblich, mit Migrationsgeschichte und nicht-linearen Arbeitsbiografien – war gewerkschaftliches Engagement somit als folgenloses Hobby für Besserverdienende diskreditiert.
„Diese Frauen sind in ihrem Alltag Löwinnen“, sagt dagegen Ongoo, die den diesjährigen Arbeitskampf als Organiserin begleitet hat. „Weil wir wussten, dass wir nur mit ihnen wirklich streikfähig sind, standen sie dieses Mal im Zentrum der verdi-Strategie“.
Schon seit Dezember hatten die Frauen mit Unterstützung von verdi und den Organiser*innen Gespräche begonnen: Mit ihren unmittelbaren Kolleginnen wie auch mit solchen in anderen Bereichen, mit denen sie aber über ihre jeweiligen Muttersprachen verbunden waren. Dabei wurde nicht nur die individuelle Streikbereitschaft abgefragt, sondern es wurden auch die Forderungen des Arbeitskampfes gemeinsam formuliert. Außerdem knüpften sie ein ziemlich engmaschiges Netz von Beteiligung und Verantwortlichkeiten und gegen die in früheren Arbeitskämpfen kritisierte Intransparenz: vom Streikpostendienst über Öffentlichkeitsarbeit bis zur Beteiligung in der Tarifkommission.
Eine dieser Netzknüpferinnen war Vida. Sie arbeitet in der „Modulversorgung“, kümmert sich also darum, dass Pflegefachkräfte und Ärzt*innen von den Einweghandschuhen bis zur Kanüle jederzeit das nötige Material griffbereit haben. Wie viele ihrer Kolleginnen war sie erst im Dezember in die Gewerkschaft eingetreten. Am 31. März war dann gut die Hälfte der CFM-Beschäftigten bei verdi organisiert, und 99,3 % von ihnen stimmten für den unbefristeten Streik.
Auf einer Streik-Kundgebung kurz vor Ostern hatten die Frauen die übliche verdi-Playlist durch Arabesque, Balkan-Beat und weitere internationale Lieblingsmusik ersetzt. Vida, Anica und ein paar andere aus der „Jugo Gang“, wie sie sich selbst nennen, erweiterten das kämpferische Redeprogramm um Bauchmuskel-Training mit Hula-Hoop-Reifen. Kurz darauf wurden die Löwinnen auch in der Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram unübersehbare Stars. Das Video „Katastrophe“ fasst die unhaltbar ungerechten Zustände in einem charmanten, alle vermeintlichen Sprachbarrieren überwindenden Chor zusammen.
Ungefähr in dieser Zeit hielt Vida bei einer Veranstaltung von „Kai Wegener vor Ort“ ihre erste Rede vor dem regierenden CDU-Bürgermeister. Die Anfrage dazu hatte sie erst am Abend zuvor erreicht: „Ich war aus dem Spätdienst gekommen, hab ja gesagt, erst mal meine Wäsche aufgehängt und überlegt, was ich sagen will.“

Aufgeregt sei sie dann schon gewesen, aber die Stichworte die ihr erfahrenere verdi-Kollegen für diesen Fall mitgegeben hatten, habe sie trotzdem nicht gebraucht. Schließlich wusste sie, wie alle ihre Kolleginnen, die in den folgenden Wochen auf Versammlungen und in Mikrofone des Lokalfernsehens gesprochen haben, aus ihrem täglichen Leben, worum es in diesem Arbeitskampf geht: Um Geld, das weder für Klassenfahrten noch fürs Fußballtraining der Kinder reicht, um den Zusammenhang zwischen Schichtplänen und der Unmöglichkeit besser Deutsch zu lernen, und um die Ignoranz anderer Krankenhauskolleg*innen gegenüber denen, die hier saubermachen. Es geht um nicht anerkannte Berufsabschlüsse, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten und in jeder Hinsicht fehlenden Respekt.
Die vielen Gespräche vor dem Streik hatten bestätigt, so Enisa, „dass wir alle ähnliche Probleme haben, egal wie unterschiedlich wir sind“. Statt diese Probleme wie sonst höchstens privat zu besprechen, kamen sie im Arbeitskampf endlich an die Öffentlichkeit und zu den Verantwortlichen. Diese seltene Chance haben die viel zu lang unterschätzen CFM-Löwinnen ergriffen. In ihren Reden ging es dann immer häufiger um Mut und Kraft, die sie sich gegenseitig geben, um Vorbilder, die sie für ihre Kinder sein wollen, und dass sie sich allein deswegen schon nicht länger mit leeren Versprechungen abspeisen lassen können. Oder, wie es Vida im „Was tun?“ Podcast für aktivistische Linke formuliert: „Wir haben verstanden, dass wir uns das, was wir brauchen nur selbst erkämpfen können“.