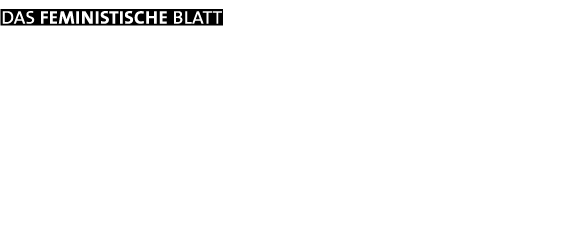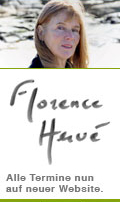Über Einsamkeit, Armut und Kultur
(aus WIR FRAUEN – Das feministische Blatt Heft 3/2025)
Christine Stender ist Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe, die sich für die „Anerkennung von Kultur als wichtigem Mittel zur Steigerung der Lebensqualität, zur Linderung von Einsamkeit und Isolation, zum Abbau von finanziellen und anderen Barrieren sowie zur Förderung der Gesundheit“ einsetzt. Außerdem ist sie Teil des Vorstands der Düsseldorfer Kulturliste. An der Universität Düsseldorf promoviert sie zum Kulturnutzungsverhalten von Menschen mit wenig oder keinem Einkommen. Klara Schneider sprach mit ihr über Einsamkeit und Armut im Kulturbereich.

Klara Schneider: Welchen Zusammenhang gibt es aus deiner Erfahrung zwischen Kultur und Einsamkeit?
Christine Stender: Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite entsteht über Kultur ein Zugehörigkeitsgefühl, weil ich mit allen Menschen um mich herum gemeinsam ein Theaterstück oder ein Kunstwerk erlebe und so in einen sozialen Austausch trete, der ohne Worte funktioniert. Auf der anderen Seite kann mich ein Kulturbesuch natürlich auch zurückwerfen: Wenn ich einen Raum sehe, der überwiegend von Menschen in Zweier-Konstellationen oder Gruppen aufgesucht wird, dann fühle ich mich vielleicht alleine.
Was weiß man über die Gründe, warum Menschen nicht an Kultur teilnehmen?
Das ist ein ganz weites Feld, deswegen hier die Kurzfassung: Bevor wir uns einzelne Barrieren an-gucken können, müssen wir unterscheiden zwischen strukturellen Faktoren, die eine selbstbestimmte Teilnahme verhindern und solchen, die Menschen individuelle Entscheidungsfreiheit lassen. Wenn exemplarisch die Infrastruktur nicht barrierefrei ist, wird einer Person im Rollstuhl die Entscheidungsmacht genommen – auch wenn sie wollte, könnte sie keinen Zugang erhalten. Der zweite, etwas weniger greifbare Punkt sind gesellschaftsstrukturelle Barrieren: Das Gefühl, nicht dorthin zu gehören, die geheimen Verhaltensregeln nicht zu kennen, den Dresscode nicht erfüllen zu können. Hier geht es viel um Annahmen, die vielleicht nie überprüft werden, weil ich mich gar nicht erst traue hinzugehen – und schon gar nicht allein. Eine tatsächlich individuelle Barriere wäre bspw. eine Geschmacksfrage: Mir sagt das Stück oder die Kommunikationskampagne oder das Genre nicht zu und deshalb verzichte ich auf einen Kulturbesuch.
Ist die Zugänglichkeit von Kultur denn auch (noch) eine Spartenfrage? Gibt es Kultureinrichtungen, die bewusst gar nicht alle adressieren wollen?
Ich glaube, laut sagen würde das heute niemand mehr und es gibt kaum eine Kulturinstitution, die sich nicht aktiv darum bemüht, neue und andere Publika zu erreichen. Aber gerade das Publikum der sogenannten „Hochkultur“ unterscheidet sich weiter durchaus vom Durchschnitt der Bevölkerung: Das Publikum ist gut verdienend, gut gebildet, weiß, älter und mehrheitlich weiblich. Demgegenüber steht rund die Hälfte der Bevölkerung, die sehr selten oder nie öffentlich geförderte Kulturveranstaltungen besucht.
In jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es sogenannte Kulturlisten. Was zeichnet sie aus?
Kulturlisten sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die versuchen, die Distanz zwischen Kulturinstitutionen und Bevölkerungsgruppen zu überbrücken, denen der Zugang zu Kultur durch Barrieren verstellt sind. Organisiert sind sie in der Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe e.V. – aktuell sind es 34 im ganzen Bundesgebiet. Ausgangspunkt ist die persönliche Vermittlung von kostenfreien Eintrittskarten an Menschen, denen weniger als 60 % vom lokalen Medianeinkommen zur Verfügung steht. Im Sinne der Intersektionalität erreichen die Kulturlisten aber auch überdurchschnittlich viele Menschen, die mit anderen Marginalisierungsfaktoren leben. Der Altersdurchschnitt ist niedriger, die Bildungsabschlüsse sind diverser als beim durchschnittlichen Kulturpublikum und es werden auch Menschen erreicht, die vor der Anmeldung wenig oder keine Kulturbesuchserfahrung hatten. Die Kulturlisten arbeiten dabei mit Veranstalter:innen und mit lokalen sozialen Einrichtungen zusammen.
Wie gehen Kulturlisten mit den Barrieren, über die wir am Anfang gesprochen haben, um?
Einige unserer Gäst:innen sind schon immer zu kulturellen Veranstaltungen gegangen und kamen durch Krankheit oder Verrentung in eine Situation, wo das nicht mehr möglich ist. Bei ihnen spielt die finanzielle Barriere die Hauptrolle. Aber dieser finanzielle Einschnitt hat ja nicht nur Einfluss auf den Kulturbesuch. Da wird dann auch die zweite Karte wieder wichtig: Der freie Eintritt gilt nicht nur für die Kulturgästin, sondern auch für eine Begleitperson. Auf diese Weise wird man in die Lage versetzt, selbst jemanden einladen zu können und kann so vielleicht wieder an das vorherige Leben anknüpfen. Neben der finanziellen Barriere ist der Erfolgsfaktor in fast allen weiteren Schritten das Vertrauensverhältnis, der persönliche Kontakt auf Augenhöhe im Vermittlungsgespräch: Dort können Rückfragen gestellt, Zusatzinformationen weitergegeben und gemeinsam über-legt werden, welche Veranstaltung interessant sein könnte. Dabei können gesellschaftsstrukturelle Barrieren überwunden werden, die oft besonders für diejenigen präsent sind, die noch nicht so oft Kulturinstitutionen besucht haben.
Muss ich mich outen als Mensch, der wenig Geld hat, um Kulturgäst:in werden zu können?
Nur vor den Kulturlisten. Am Veranstaltungsort steht mein Name auf der Gästeliste und der könnte da genauso stehen, wenn ich die Karten reserviert habe. Die Vereine sind sich natürlich bewusst, dass die direkte Anmeldung eine Überwindung darstellt. Hier kommen die sozialen Partnerorganisationen ins Spiel: Sie können die Anmeldung stempeln und damit die finanzielle Situation bestätigen. Ganz viele der Menschen, die sich direkt anmelden und nicht über einen Sozialpartner, tun das auf Empfehlung aus dem persönlichen Umkreis.
Was hat deine Forschung ergeben, wen Menschen mit ihrem zweiten Ticket mitnehmen?
Befragte, die sich außerhalb der binären Geschlechterordnung einordnen, lass ich jetzt mal raus, weil eine statistische Auswertung aufgrund der geringen Fallzahl schwierig ist. In der binären Genderzuordnung sieht man zunächst, dass Männer häufiger alleine gehen als Frauen. Wenn Männer zu zweit gehen, dann überwiegend mit ihren Partner:innen. Der Großteil der Frauen nimmt dagegen Freundinnen oder Bekannte bzw. Kinder oder Enkelkinder mit. Gerade für Mütter oder Großmütter ist der Kulturbesuch den Zahlen nach auch Teil von Care- und Erziehungsarbeit. Das ist an sich gar nicht so überraschend, aber dass es sich auch in so einer Umfrage, die eigentlich überhaupt nichts mit Care- und Erziehungsarbeit zu tun hat, so deutlich abzeichnet, das hat mich schon erstaunt.
Was ist mit den Menschen, die niemanden haben, den sie mitnehmen könnten?
Es gibt viele Kulturlisten, die so etwas wie ein Gästecafé oder Kulturfrühstück haben, das unabhängig von einer kulturellen Veranstaltung angeboten wird. Ziel ist es, dass sich zum einen die Gäst:innen kennenlernen, zum anderen die Gäst:innen und die Ehrenamtlichen Kontakte knüpfen und letztendlich über dieses Kennenlernen vielleicht gemeinsame Kulturbesuche entstehen.
Oft werden auch gemeinsame Besuche organisiert: von sogenannten Kulturtandems, bei denen zwei Gäst:innen oder eine Gästin und eine Ehrenamtliche zusammen zu Veranstaltungen gehen, bis hin zu größeren Gruppen. Bei der Kulturliste Düsseldorf heißt das Angebot bspw. Kulturfreund:innen. Hier begleiten ein bis zwei Ehrenamtliche bis zu zehn Gäst:innen. Als Gruppe geht man auch vor der Veranstaltung oder in der Pause zusammen etwas trinken und darüber können wiederum neue Zweierkonstellation entstehen.
Was kann ich tun, wenn ich selbst mitmachen will als Ehrenamtliche oder als Gäst:in?
Auf der Webseite www.kulturelleteilhabe.de sind alle Initiativen gelistet. Wenn es in der eigenen Stadt noch keine Kulturliste gibt, kann man auch selbst eine gründen und sich – bei Bedarf – dafür von uns im Bundesvorstand Unterstützung holen.