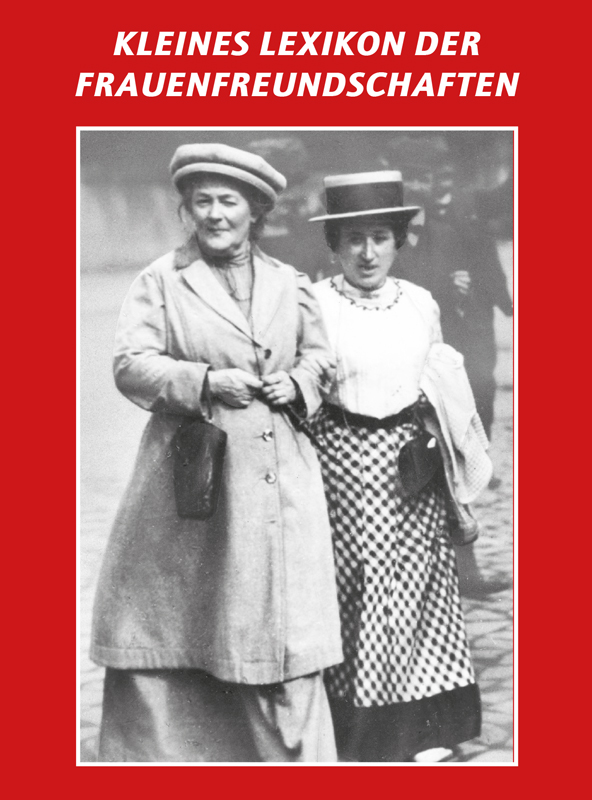Kritik braucht Luft zum Atmen
von Isolde Aigner
(aus WIR FRAUEN Heft 2/2022: Kritik)
Frei nach dem Philosophen Michel Foucault, beschreibt Kritik den Versuch, Denken aufzustöbern und zu verändern. Sie stellt in Frage, was selbstverständlich erscheint. Kritik macht es sich nach Foucault außerdem zur Aufgabe, Dinge, die leicht von der Hand gehen, schwerer zu machen.
Warum ist Kritik so wichtig für emanzipatorische Prozesse in unserer Gesellschaft?
Kritisches Denken und Hinterfragen sind ein Lebenselixier für eine lebendige Gesellschaft, die nicht im Statischen und Unveränderlichen verharrt. Gesellschaftskritik steht außerhalb vorherrschender, mehrheitsfähiger Positionen, gibt sich nicht mit dem Status Quo zufrieden und legt den Finger in die Wunde. Dabei wird das vermeintlich Selbstverständliche in Frage gestellt.
Denn das, was als „normal“ gilt, ist eine Machtfrage und steht in Verbindung mit (teils gesetzlich legitimierten) Ausschlüssen und Diskriminierungen, wie zum Beispiel die Pathologisierung von Trans*Personen. Kritisches Hinterfragen kann außerdem dazu beitragen, unsere Horizonte zu erweitern, in dem wir uns mit anderen Perspektiven auseinandersetzen und diese anerkennen. Kritik ist das Gegenteil zu Apathie und Gleichgültigkeit.
Wer Kritik äußert – und mag er sich in jenem Moment noch so ohnmächtig fühlen – der hat immer auch ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit und eine Idee von einer besseren Gesellschaft. Auf diese Weise kann ein kritisches Bewusstsein immer auch Ausgangspunkt für Utopien, Träume, Visionen sein und auf Veränderung drängen. Eine Gesellschaft ohne Kritik ist hingegen tot, vergleichbar mit einem versteinerten Gehäuse.
Ohne Kritik sind kein gesellschaftlicher Wandel, keine Emanzipation möglich. Unzählige dystopische Fiktionen führen uns vor Augen, wie so eine Welt aussehen wurde: automatisierte Tagesabläufe und uniforme Gestalten mit leeren Gesichtern, die jedes Gefühl von Sehnsucht, Hoffnung und wahrhaftiger Freude verloren oder nie gekannt haben.
Welchen Herausforderungen stellt sich Kritik heute?
In unserer immer komplexer werdenden Welt, die sich durch widersprüchliche Entwicklungen auszeichnet, wird Kritik zumeist nicht einfach unterdrückt, sondern vereinnahmt. So wird ihr die Schlagkraft genommen, sie wird als unzeitgemäß verworfen oder tabuisiert.
Einerseits gewinnen zunehmend Personen und auch Meinungen an Einfluss, die für eine vielfältigere Gesellschaft stehen und den Status Quo der Mehrheitsgesellschaft in Frage stellen. Andererseits formiert sich eine konservative, oft rechte Front gegen diese Stimmen: Feministinnen, Journalistinnen, queere oder muslimische Aktivist*innen erfahren Shitstorms und Hatespeech bis hin zu Morddrohungen. Mitunter werden Meinungen entgegen des Malestreams zu angeblich machtvollen Positionen hochgejazzt: „Man darf ja gar nichts mehr sagen!“, heißt es dann. Die Journalistin Margarete Stokowski erkennt darin Abwehrkampfe in den „letzten Tagen des Patriachats“, das bis aufs Blut verteidigt wird.
Auch vermeintliche Modernisierungen im Geschlechterverhältnis können feministischer Kritik die Schlagkraft nehmen. Antonio Gramsci prägte den Begriff der „passiven Revolution“: Die herrschende Klasse räumt Zugeständnisse ein, zumindest für einige, mit dem Ziel, ein paar wenige in den Machtblock zu integrieren, „die unteren“ zu spalten, den Konflikt zu befrieden und Herrschaft weiter zu sichern. So belegen einzelne Ausnahmekarrieren z.B., dass Frauen heute alles schaffen können – sie müssen sich nur richtig reinhängen.
Wer braucht da also noch Feminismus? Nach der Soziologin Angela McRobbie wird dadurch eine feministische Kritik, die weitreichende und grundlegende Veränderungen einfordert, als unzeitgemäß verworfen.
Nicht zuletzt ist es der politische und öffentliche Umgang mit Krisen (Corona, Ukraine-Krieg), der das Sagbare massiv einschränkt. Staat und Öffentlichkeit werden in Alarmbereitschaft versetzt und unter Zugzwang gesetzt, blitzschnell handeln zu müssen. Keine Zeit für Analysen, Nachdenken, Zögern oder Hinterfragen.
Gabriele Krone-Schmalz – ihre Bücher werden nun nicht mehr verlegt –, bedauert die „semantische Umwidmung des Begriffs „Verstehen“ im Sinne von zustimmen und Verständnis haben. Es bedeute doch auch „begreifen“ – und sei das nicht die Voraussetzung, um vernünftig und sachlich angemessen zu handeln?
Das regierungspolitische Vorgehen, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern und lokale Streitkräfte im Umgang mit diesen Waffen auszubilden, wird als alternativlos ins Feld geführt. Der „Offene Brief an Kanzler Olaf Scholz“, der sich dagegen aussprach, um eine weitere Eskalation des Krieges abzuwenden, löste große Empörung aus. Der Verein für Frauen war fassungslos und sprach davon, so wurden ukrainische Frauen den Aggressoren schutzlos überlassen.
Warum aber löst die Kritik am militärischen Vorgehen solche Reaktionen aus? In Kriegszeiten sind die Debatten oft durchdrungen von Moral. Es geht z.B. um Freiheit und Demokratie an sich und weltweit, nicht um Kontexte und konkrete Interessen. Gefordert ist die „richtige Haltung“: Entschlossenheit, Führung, Ehre, Rückgrat, Respekt, Empörung, Loyalität, Mitgefühl… Über den Tonfall einer Kritik wird dann mitunter mehr diskutiert als über ihren sachlichen Inhalt.
Der Literaturwissenschaftler Jürgen Link erklärt, dass gerade in Kriegs- und Krisenzeiten ein „binärer Reduktionismus“ um sich greife: Es gibt nur noch Raum für „Schwarzweiß“ und „good guys-bad guys“, das keine differenzierenden Zwischentöne mehr zulasst. Das aber mache es fast unmöglich, über politische Entscheidungen in ihrer Komplexität zu diskutieren oder Fragen zu stellen.
„Unabhängig von der Schuldfrage besteht die Frage der Verantwortung für den Frieden weiter, und diese Verantwortung tragen alle Beteiligten“, gab Elsa Köster schon Ende Februar im Freitag zu bedenken.
Kritik ist lebensnotwendig, aber sie braucht Luft zu atmen!
Nach dem Philosophen Theodor W. Adorno bedarf unsere Demokratie kritischer Impulse und wird durch sie geradezu definiert. Ohne Kritik kann es keine lebendige Demokratie und friedliches Miteinander geben. Kritik ist lebensnotwendig. Doch dieser unermüdliche und niemals abgeschlossene Prozess braucht Luft zum Atmen: in Form von Zeit und Raum, um in Ruhe nachzudenken, um innezuhalten, zu zögern und zu wachsen. Oder um die eigene Position eher als Unterwegs-Sein zu begreifen und sie in einem „Weder noch, lieber irgendwie anders“ (Jürgen Link) zu verorten.
In dieser Ausgabe
Auf den kommenden Seiten beleuchtet Annegret Kunde das Für und Wider, die Chancen und Risiken von Identitätspolitik. Isolde Aigner setzt sich mit dem Konzept der Brave Spaces (mutige Raume) – in Abgrenzung zu Safe Spaces (sichere Raume) – auseinander. Sie zeigt auf, wie Brave Spaces – am Rande der eigenen Komfortzone – für die Bildung feministischer Allianzen nutzbar gemacht werden können. Nerocy Chanthirakanthan erzählt von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Hochstapler*innen-Syndrom. Annegret Kunde setzt sich mit den Ursachen und Gefahren von sogenannten Shitstorms und Cancel Culture auseinander und fragt nach den Auswirkungen auf die (digitale) Diskussionskultur. Tina Berntsen schreibt darüber, wie mächtige Konzerne und Einzelpersonen mit SLAPP-Klagen Gesetze missbrauchen, um Kritiker*innen zum Schweigen zu bringen.