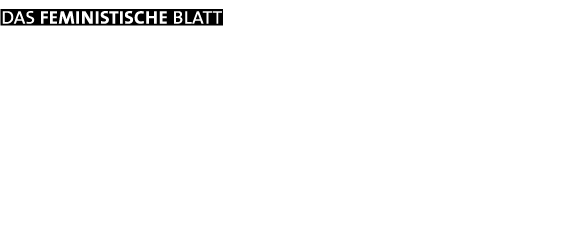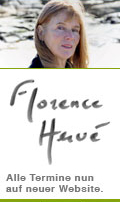Grenzen
von Melanie Stitz
Wir planen unsere Ausgaben mit langem Vorlauf – es ist also schon etwas her, dass wir lebhaft und frei Ideen gesammelt haben, wovon unser Heft „Grenzen“ wohl handeln könnte.
No border! – na klar! Grenzen hindern Menschen daran, sich frei zu bewegen, schließen aus und ein. Zumindest gilt das für manche, nicht für die Reichen, nicht für die mit dem richtigen Pass und nicht für Kapital auf der Flucht in die Steueroase.
Grenzen wurden und werden am Reißbrett gezogen: Sieger und Kolonialherren nahmen Lineal und Zirkel zu Hand und teilten die Welt unter sich auf. Mythen und Geschichte werden bemüht, um zu belegen, dass dabei nur ins Recht gesetzt wird, was immer schon war oder von Gott so gewollt ist. Und manchmal war ja vorher angeblich auch überhaupt niemand da – zumindest niemand, der Mensch genug wäre, um Besitz anzumelden. Zaunreiterinnen, Nomad*innen, Migrant*innen, die Grenzen queren und nicht dingfest zu machen sind, galten oft als suspekt.
Militärisch werden Territorien und Handelswege gesichert. „Wir“ müssen „unseren“ Wohlstand verteidigen, schließlich haben wir ihn uns redlich verdient. Zynisch wird abgewehrt, was Marx einmal schrieb und immer noch gilt: dass „das Kapital von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, blut- und schmutztriefend“ zur Welt kam. Kein Grund, sich rund um die Uhr schuldig zu fühlen, aber doch Anlass, zu fragen, wessen Reichtum, auf wessen Kosten erworben, da verteidigt werden soll.
Dann gibt es Grenzen, die finden wir, ehrlich gesagt, wichtig und richtig, die wollen wir auch verteidigen: um unsere Integrität, unseren Körper, unseren Ort in der Welt, im Bus wie auf der Bühne zu schützen. Auch Grenzen von Wachstum und Machbarkeit, von Ressourcen wie Wasser, Erze, Ackerland oder Energie gilt es zu achten, für das Leben auf diesem Planeten.
Als wir so miteinander laut dachten, ahnten wir nicht, wie bedeutsam das Thema noch werden würde, in mehrfacher Hinsicht.
Wir sind im Krieg – wie sehr schon, darüber wird noch diskutiert. EU-Kommissar Thierry Breton möchte die EU auf „Kriegswirtschaft“ umstellen. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger fordert Zivilschutzübungen an Schulen und ein „unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr“. Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte das Gesundheitswesen für „eventuelle militärische Konflikte besser aufstellen.“ Auch die Wiedereinführung der Wehrdienstpflicht ist im Gespräch.
Velten Schäfer schreibt sarkastisch dazu im Freitag (8/2024):
„Dieser Mut zum Riskieren der Kinder anderer Leute nähme ab, wenn bewusster wäre, dass nicht nur Kevin aus Anklam und Dustin aus Altenessen zum Verrecken geschickt werden können, sondern auch Finn-Ludwig vom Berliner Helmholtzplatz. Eine erneuerte Wehrpflicht riefe in Erinnerung, dass der Staat noch immer das Recht hat, auf die Leben aller männlicher Erwachsenen zuzugreifen. Und ihre Handhabung nach Art der 1960er schlösse es aus, Waffenlieferungen zu befürworten, sich aber selbst vor dem Schießen zu drücken. Und dass die Kriegsbesorgnis steigt, je näher man dem Mündungsfeuer kommt, zeigen Daten aus der Truppe: Die Zahl derer, die als Berufssoldaten eine nachträgliche Verweigerung eingereicht haben, hat sich zuletzt verfünffacht.“
Nachdem geleakt wurde, was eigentlich kaum überrascht – die Remigrationspläne der AfD – gab das Nachrichtenmagazin Panorama im Februar eine Umfrage in Auftrag. 51 % der Befragten mit Migrationshintergrund (und 48 % der Befragten ohne) gaben an, dass ihnen die Pläne große oder sehr große Angst bereiten.
Während Millionen von Menschen dagegen demonstrierten, beschloss man im Bundestag das „Rückführungsverbesserungsgesetz“ – mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, FDP und – mit einzelnen Ausnahmen – Bündnis 90/Die Grünen. Anfang April hat das EU-Parlament die umstrittene EU-Asylreform mit verschärften Regelungen und schnelleren Abschiebungen final gebilligt.
Unentwegt führen wir Kämpfe um Sagbarkeit und ihre Grenzen. Sagbarkeit und Denkbarkeit hängen eng miteinander zusammen. Auch darum streiten viele für uns für den Glottisschlag, jene winzige Pause vorm Binnen-I, und das Gender-Sternchen – eine Anerkennung all jener, die sich zwischen oder jenseits von nur zwei Geschlechtern verorten und derart brisant, dass es jetzt auch an bayerischen Schulen, Hochschulen und Behörden ausdrücklich verboten ist.
Zu sagen was ist, damit und dafür kämpften und kämpfen Feminist*innen damals wie heute. Ob Missbrauch, Vergewaltigung in der Ehe, Femizid – oder auch freudvoll wie Vulva: Worte sind machtvoll und befreiend, ermöglichen (Selbst-)Verständigung und Vernetzung.
In der Ausgabe „Grenzen“
Auf den kommenden Seiten denkt auch Isolde Aigner über Grenzen des Sagbaren nach und plädiert für mehr Ambiguitätstoleranz. Annegret Kunde hat zur Technisierung der Grenzüberwachung, und welche Rolle KI dabei spielt, recherchiert. Anni Mertens schreibt über die Bedeutung der Diaspora für die feministische Bewegungsgeschichte. Dazu veröffentlichen wir einen Auszug aus dem Aufsatz „Schwarzer Feminismus der Grenze“ von Céline Barry. Viola Steiner-Lechner beschreibt, wie die Metoo-Debatte auch in der Theater-, Musik- und Literaturszene wirkt und stellt das Berufsfeld der Intimitätskoordination vor. Gabriele Bischoff erklärt, was Staatenlosigkeit bedeutet und welche Chancen vertan wurden bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Mit Grenzen beschäftigt sich auch Kreideaufbeton aus Regensburg – ihrer Kreide-Wort-Kunst geben wir auf den Seiten „Meine feministische Wahrheit“ Raum.