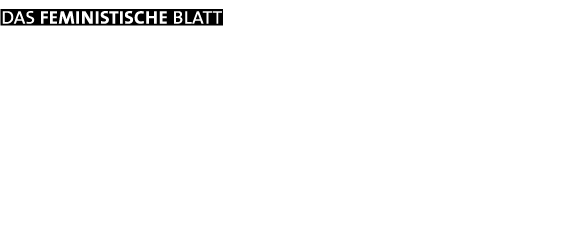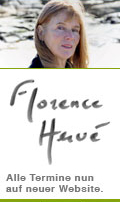Einsamkeit
von Melanie Stitz
(aus WIR FRAUEN – Das feministische Blatt Heft 3/2025)
Vor einem Jahr stellte die damalige Bundesfamilienministerin Lisa Paus die Ergebnisse des Einsamkeitsbarometers mit Daten aus 2021 vor. Demnach nimmt Einsamkeit zu, besonders betroffen sind Frauen, vor allem Alleinerziehende, womit sich eine weitere Geschlechterdifferenz auftut: der Gender Loneliness Gap. Das Risiko, sich einsam zu fühlen, erhöht sich durch Armut, Migrationserfahrung und Sorgeverantwortung (taz, 30.5.2024).
Wir erleben eine Einsamkeitskrise von globalem Ausmaß, so die britische Ökonomie-Professorin Noreena Hertz. Die dramatische These belegt sie in ihrem Buch „Das Zeitalter der Einsamkeit“ (2021) auf über 400 Seiten mit unzähligen Beispielen: Immer weniger Menschen geben an, Freund*innen zu haben. Blickkontakte reduzieren sich im Alltag messbar. In Japan verschulden sich junge Frauen, um stundenweise eine Freundin zu mieten. Einsamkeit senkt die Lebenserwartung und macht kränker als Rauchen, fördert messbar Ressentiments und Demokratiefeindlichkeit, lässt Orte und soziale Kompetenzen veröden. Ein Markt ist entstanden, auf dem (Pseudo-)Gemeinschaft verkauft wird: Dienstleistungen und Produkte versprechen Nähe und Zugehörigkeit – eine Strategie, die sich „We Washing“ nennt. In Co-Living-Spaces – meist hochpreisige Apartmentanlagen – organisieren professionelle Animateur*innen den Grill- oder Spieleabend: unverbindlich, bequem und risikoarm für die Kundschaft. Allzeit sexuell willig ist Roboter Harmony und der/die/das niedliche Pepper-Modell geht im Haushalt zur Hand und kann im Alter versorgen.
Diese Entwicklungen sollten wir als Aufforderung sehen, uns „ausnahmslos menschlicher zu verhalten als Roboter und vielleicht sogar von Robotern zu lernen, bessere Menschen zu werden“, so Hertz.
Ursächlich seien der Neoliberalismus und wir darin. Das Leitmotiv „Geiz ist geil“, das Streben nach Profit, das Hohelied der Eigenverantwortung, die damit einhergehende Unversorgtheit und Empathielosigkeit – all das trennt und zerstört. Armut schließt aus. Städtische Architektur sabotiert das Verweilen, verweist Marginalisierte buchstäblich vom Platz und trennt nach Herkunft und Einkommen schon auf dem Spielplatz. Einsamkeit ist die Folge: das Gefühl, die Erfahrung, der Fakt, allein und unbehaust zu sein, nicht zu zählen und nicht wahrgenommen zu werden.
Es gelte, so Hertz´ befremdlicher Vorschlag, „das Gemeinwohl wieder in den Kapitalismus zu holen“. Der sei nämlich nicht das Problem. In diesem Sinne setzt sie auf fürsorgliche politische Stellvertretung, auf Herz und Anstand von Unternehmern und schließlich auf jede*n von uns: mal wieder aufschauen vom Handy und einander grüßen; auf der Parkbank Gespräche anstoßen; mit anpacken und Auseinandersetzungen suchen, statt Gemeinschaft nur zu konsumieren und darauf zu setzen, dass jemand anders sie für einen baut. Dazu brauche es andere Städte, mehr Zeit fürs Ehrenamt und deutlich weniger Social Media.
Vieles davon ist sicher richtig, reizt aber auch zum Widerspruch. Gilt das wirklich für alle – und überall auf der Welt? Ist das Problem tatsächlich neu?
Carola Lipp nennt in „Kurzer Versuch zum Thema Einsamkeit“ weitere Epochen, in denen Einsamkeit ein wichtiges Thema war, in Alltag, Kunst und Wissenschaft. Da waren zum Beispiel die Umbrüche, Bevölkerungsbewegungen und das Aufkommen der Städte im 16. und 17. Jahrhundert sowie die Kriege der frühen Neuzeit, in denen der Verlust geliebter Menschen geteilte Erfahrung war, Menschen sich fremd und verloren fühlten und von den Herrschenden vermutlich wenig „gesehen“.
Wer problematisiert also Einsamkeit und zu welchen Zwecken? Welche Vorschläge drängen sich auf? Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen Schulen und Krankenhäuser „kriegstauglich“ gemacht werden sollen, soziale Sicherungssysteme zersetzt werden, Verachtung gegen Bürgergeldberechtigte geschürt wird und es an Antworten auf die Frage fehlt, wer uns im Alter pflegt und versorgt?
Prompt hat das Loblied auf ehrenamtliches Engagement Konjunktur, werden vermeintliche Stärken von Frauen mal wieder wertgeschätzt und sollen zumindest „ordentliche“ deutsche Familien geschützt werden. Wenn in der Politik „echte Männer“ gebraucht werden (siehe Ausgabe 2/2025), bedarf es der Frauen daheim. Damit niemand einsam ist in solchen Verhältnissen und womöglich auf Abstand geht zu solcher Art Demokratie?
Bis an die Schmerzgrenze erkunden Aktivist*innen aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Europa und den USA in Bildern, Gedichten und Texten Einsamkeit und Alleinsein in kollektiven Kämpfen in einem von Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn herausgegebenen Buch. Der Titel „Left Alone“ ist mehrdeutig, zu Deutsch in etwa: allein gelassen / links allein / alleine links. Kollektiv wie als Einzelne am linken Anspruch zu scheitern, inklusiv und solidarisch zu sein und sich mit anderen im Kollektiven zu üben, das schmerzt besonders. Aber auch davon erzählt der eine oder andere Beitrag: von der Entscheidung, zu dieser Gesellschaft oder Gemeinschaft nicht zu gehören – es nicht zu wollen, nicht zu können, dafür den eigenen Idealen treu zu sein und sich nicht korrumpieren zu lassen.
Gab es nicht in manchen auch eine heimliche Lust am Lockdown, ein Gefühl der Entlastung, ob der Erlaubnis zum Rückzug, zumal noch als „solidarisch“ verklärt? Und auch ein „Zimmer für sich allein“ hat als feministischer Sehnsuchtsort eine lange Geschichte.
Zum Thema Einsamkeit hat Laura Meritt in der 23. Ausgabe von Mein lesbisches Auge Beiträge zusammengestellt, die einander ergänzen und widersprechen: Einsamkeit hat unendlich viele Gesichter und Facetten, ist schrecklich, lustvoll, trifft uns allein im Bett und im Beisein von vielen, ereilt Queers jenseits einer fürsorglich-solidarischen Community auf besondere Weise, erfasste in Zeiten der Pandemie die ausgeschlossenen Ungeimpften ebenso wie diejenigen, die sich isoliert haben. Die Unmöglichkeit, darüber zu sprechen, riss Wunden, die noch nicht verheilt sind. Auch davon handeln zwei Texte aus unterschiedlichen Perspektiven. Und Albertine schreibt in ihrem Beitrag „In meiner schönen Seifenblase“: „Wenn ich denke, keine kann mich leiden – heißt das oft auch: ich kann gerade so keine richtig leiden. Und dann muss ich mich fragen, wie ich mich wieder einer zuwenden kann“. Anna Breitenbach ist mit Gedichten vertreten. Eins davon lautet: „Die Tür zu mir. Wenn die Tür zu / lange zu war / geht sie sehr / schwer und nur / von außen nach / innen noch auf.“ Auch das ist entscheidend: ob wir den Weg zu anderen finden, wenn wir des Alleinseins leid sind – aus eigener Kraft oder weil uns jemand dabei hilft und mit offenen Armen empfängt.
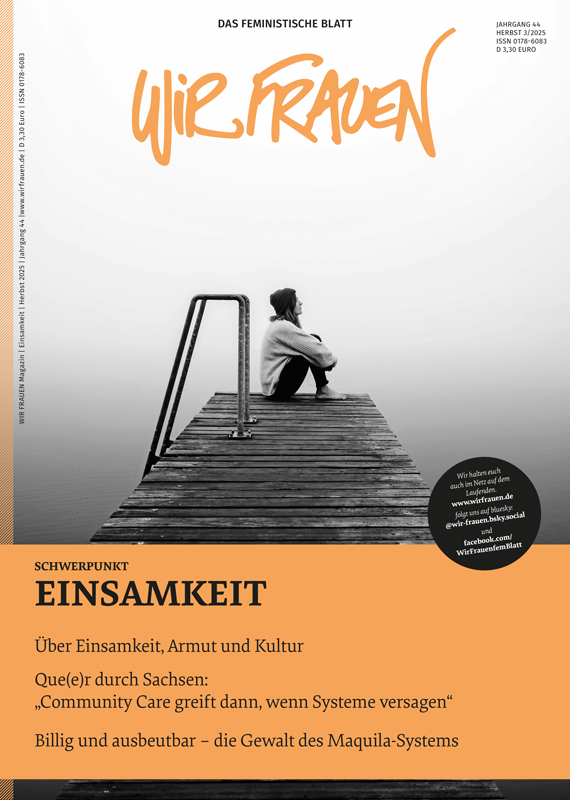
Auf den Seiten im Schwerpunkt hinterfragt Isolde Aigner, warum alleinstehende Frauen so oft als defizitär angesehen und beschämt werden. Klara Schneider stellt ein Projekt vor, das von Armut betroffenen Menschen Kulturbesuche und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Kefah Ali Deeb, geflohen aus Syrien, berichtet von Einsamkeit und Verzweiflung bei ihrer Ankunft in Deutschland. Über Isolationshaft als Folter schreibt Annegret Kunde. Florence Hervé erzählt von einer Leuchtturmwärterin und einer Künstlerin, die mitten in der Wüste ein Theater betreibt. In der Rubrik Kultur (S. 27) schreibt Christiana Puschak über die Lyrik Mascha Kalékos, in der Einsamkeit ein wiederkehrendes Motiv ist.
Literatur:
Laura Méritt (Hrsg.): Einsamkeit. Mein lesbische Auge 23, konkursbuchverlag 2024.
Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn: Left Alone: On Solitude and Loneliness amid Collective Struggle, Daraja Press 2023.