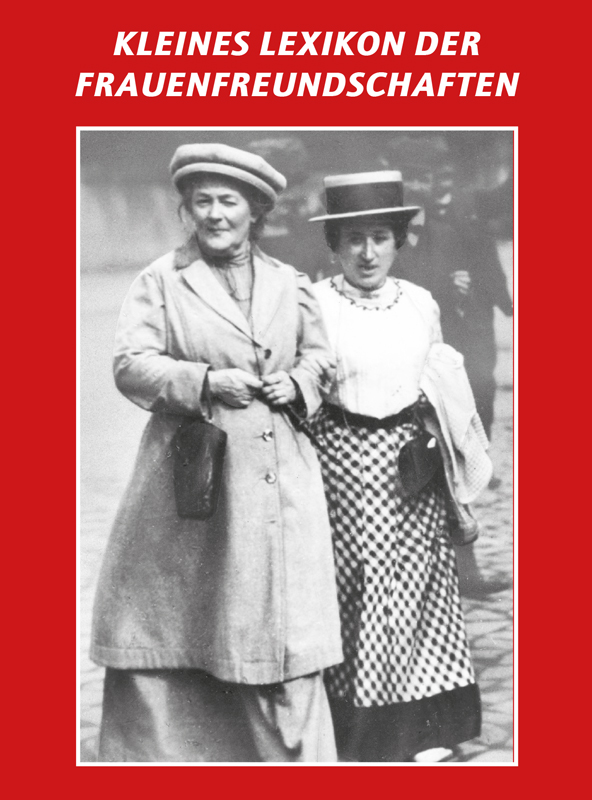Feministische Stadt
von Melanie Stitz
(aus WIR FRAUEN Heft 3/2021)
Keiner unserer älteren und längst vergriffenen Ausgaben wird so oft nachgefragt, wie jene zu feministischer Stadtplanung von 2003 und 2012. Anlass genug, dem Thema erneut einen Schwerpunkt zu widmen.
Architektur bildet Lebensweisen ab, lenkt unsere Wege, bestimmt unseren Alltag, ermöglicht und verhindert Begegnung und die Bewegungen unserer Körper im Raum. Das gilt auch für die legendäre Frankfurter Küche, Urmodell der Einbauküche, 1926 entworfen von Margarete Schütte-Lihotzky – alles ist mit einem Handgriff bequem zu erreichen. Sie wollte Wege und Bewegungen verkürzen, unbezahlte Hausarbeit aufwerten und erleichtern, so dass Frauen mehr Zeit bliebe für sich und ihre Emanzipation durch ökonomische Unabhängigkeit. Zugleich arbeiteten die Frauen in der kleinen, meist hinter dem Esszimmer verborgenen Küche isoliert. Die Wohnung allein böte ausreichend Stoff für ein eigenes Heft: Wie können wir Alltag gemeinschaftlich organisieren? Welchen Raum brauchen wir nur für uns? Wo trennen und verbinden sich Innen und Außen? Wie haben sich Arbeitsteilungen, Klassen-, Macht- und Geschlechterverhältnisse in den Schnitt unserer Wohnungen eingeschrieben? Normierte Grundrisse bilden in der Regel die Ideologie der bürgerlichen Kleinfamilie ab – die Architekturkritik der zweiten Frauenbewegung setzte dagegen auf multifunktionale Räume. Mit ihrer Dissertation über das „Emanzipationshindernis Wohnung“ (1978) stieß die deutsch-israelische Architektin Myra Warhaftig eine rege Debatte zu Frauen-Bedürfnissen im Wohnungsbau an. „Durch gelebte Erfahrungen“, schrieb die feministische Design-Kooperative Matrix 1981 in ihrem Manifest, „haben Frauen eine andere Perspektive auf ihre Umgebung als die Männer, die diese geschaffen haben.“ Sie entwickelten die Pläne für das Londoner Jagonari Educational Resource Centre in Workshops gemeinsam mit den künftigen Nutzerinnen und unternahmen einen „Ziegelstein-Picknick“-Spaziergang, um herauszufinden welche Materialien und Farben den Frauen besonders gefielen.
Der Schritt vor die Haustür: In vielerlei Hinsicht dominiert der Autoverkehr die Struktur einer Stadt. Wem gehört die Straße und wo können wir verweilen, wenn wir nicht konsumieren? Wie werden Orte zu „No-Go-Areas“ und für wen – für Linke, für Frauen, für Queers, für Migrant*innen, für sogenannte „anständige Bürger*innen“ oder angeblich sogar für die Polizei? Wie wird mit „Sicherheit“ Politik gemacht und Repression legitimiert?
Vielerorts laden Initiativen zu politischen Stadtrundgängen ein: über Stolpersteine und die gerne übertünchten Erinnerungen an jüdisches Leben und faschistische Verfolgung, auf der Suche nach Frauengeschichte(n), aus der Sicht von Obdachlosen oder Geflüchteten oder Migrant*innen, mit Kinderwagen, Rollator, Fahrrad oder im Rollstuhl, mit Blick auf den Leerstand und mit der Frage im Rucksack, wie dieser genutzt werden könnte, mit den Grannys for Future zum Umweltspaziergang… Viel lässt sich so lernen über Macht, Gewalt, Ausschlüsse, Barrieren, Eigentumsverhältnisse, Teilhabe und Repräsentation. Die Stadt ist umkämpftes Territorium: Da werden Rom*nja in Duisburg mit dem Vorwand des Brandschutzes von der städtischen „Task Force“ brutal aus ihren Wohnungen vertrieben oder Menschen für Bauprojekte bis zum Auszug gemobbt.
In den 60er Jahren prägte die Soziologin Ruth Glass den Begriff Gentrifizierung für eine Entwicklung, die sie am Beispiel des Londoner Viertels Islington beobachtet hatte: Nach und nach verdrängten finanziell stärkere die alteingesessenen, ärmeren Anwohner*innen. Das Engagement für eine lebenswerte Stadt für alle bewegt sich in Widersprüchen und läuft Gefahr, vereinnahmt zu werden: Solidarität, Kreativität und Engagement lassen sich ausbeuten – und das wird auch zielgerichtet getan. Wunderbar, wenn die Mittellosen sich selbst organisieren, wo es an grundlegender Infrastruktur fehlt; wenn Ehrenamtliche unbezahlt arbeiten, um Notstände zu lindern; wenn das kreative Prekariat und Freie Kunstszene das Viertel beleben oder die alternative Szene die Brachflächen begrünt, Telefonzellen in Bücherschränke verwandelt und Laternen umstrickt…
Im Lokalen und direkt vor unserer Haustür erfahren wir Wirkmächtigkeit und zugleich deren Grenzen. Austeritätspolitik z.B. wird zwar vor Ort umgesetzt, jedoch auf mindestens europäischer Ebene gemacht. In einer armen Stadt, in der Flächen und Immobilien in private Hände verkauft sind, unter dem absurden Diktat der „schwarzen Null“, lässt sich demokratisch, sozial und von unten wenig gestalten. So streiten stadt- und mietenpolitische Initiativen auch für Vorkaufsrechte von Genossenschaften gegenüber privaten Konzernen, mehr Sozialwohnungen, Mietendeckel, Bußgelder für Airbnb und demokratische Mitbestimmung.
Manche schaffen als Hausbesetzer*innen Fakten. Um Unterkunft für Geflüchtete zu schaffen und „weil Leerstand Gewalt ist“, besetzten Aktivist*innen 2016 in Köln zwei leerstehende Wohnhäuser und erzielten schließlich mit Stadt und Eigentümer eine Einigung, die als „Kölsche Lösung“ für Aufsehen sorgte. Im Juni übergab die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ 349.658 Unterschriften an die Berliner Landeswahlleitung und schrieb damit Geschichte. Ihr Ziel: Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen eine Entschädigung deutlich unter Marktwert zu vergesellschaften. Dazu soll es im September einen Volksentscheid geben. Das Netzwerk „Feministisch enteignen!“, Teil der Kampagne, weist darauf hin, dass es erschwingliche Wohnungen braucht, damit Frauen gewalttätige Partner verlassen können. Sie fordern zudem eine Infrastruktur, welche überhaupt erst ermöglicht, für sich und andere zu sorgen.
Städte wie Madrid, Barcelona oder Wien lassen erahnen, wie eine „Sorgende Stadt“ aussehen könnte. Unter dem Motto „Decolonize the City!“ streiten Initiativen aus antirassistischer Perspektive für gute Lebensbedingungen, ökonomische Gleichheit und die Umbenennung von Straßen und Plätzen, die unkritisch an Kriegsverbrecher und Kolonisatoren erinnern. Women in Exile, eine Initiative geflüchteter Frauen, stellt sich gegen die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und fordert ein Ende der Diskriminierung bei der Wohnungssuche: Menschen mit ausländischem Namen werden seltener zu Besichtigungen eingeladen, Mitarbeiter*innen der landeseigenen Wohnungsgesellschaften sollen entsprechend sensibilisiert werden. In „Solidarischen Städten“ sollen alle Menschen das Recht haben zu leben, zu wohnen und zu arbeiten, Zugang haben zu Bildung und medizinischer Versorgung, niemand wird gefragt nach seinem Aufenthaltsstatus, niemand wird abgeschoben.
In solchen Utopien und Kämpfen geht es um alles und stets um die Frage: Wie wollen wir – in all unserer Unterschiedlichkeit, mit unseren verschiedenen Bedürfnissen und Verwundbarkeiten miteinander leben? Sie zielen auf demokratische Gestaltung und eine Orientierung am Gemeinwohl statt an Profit und Kapitalinteressen.
In dieser Ausgabe widmet sich Tina Füchslbauer der Wohnungslosigkeit und fragt, was sie insbesondere für LGTBIQ+-Personen bedeutet. Gabriele Bischoff stellt Initiativen vor, die grüne Flächen selber machen und Annegret Kunde Visionen für eine geschlechtergerechte, lebenswerte Stadt der Zukunft. Duygu Gürsel, Azozomox und Marie Schubenz erinnern an Kämpfe migrantischer Mieter*innen. Zudem veröffentlichen wir Auszüge aus einem Interview, das Tyma Kraitt mit der Architektin, Stadtplanerin und Aktivistin Gabu Heindl über Stadtkonflikte, Public-Private-Partnerships und das Rote Wien geführt hat.
Für alle, die tiefer eintauchen wollen, stellen wir auf unserer Webseite zudem unsere älteren Ausgaben zu Stadtplanung als Download zur Verfügung sowie eine umfangreiche kommentierte Link- und Leseliste.